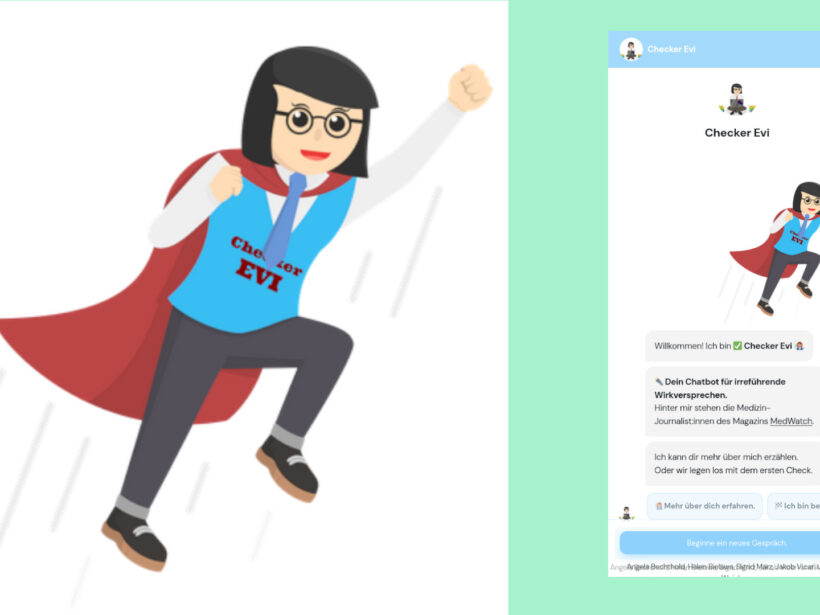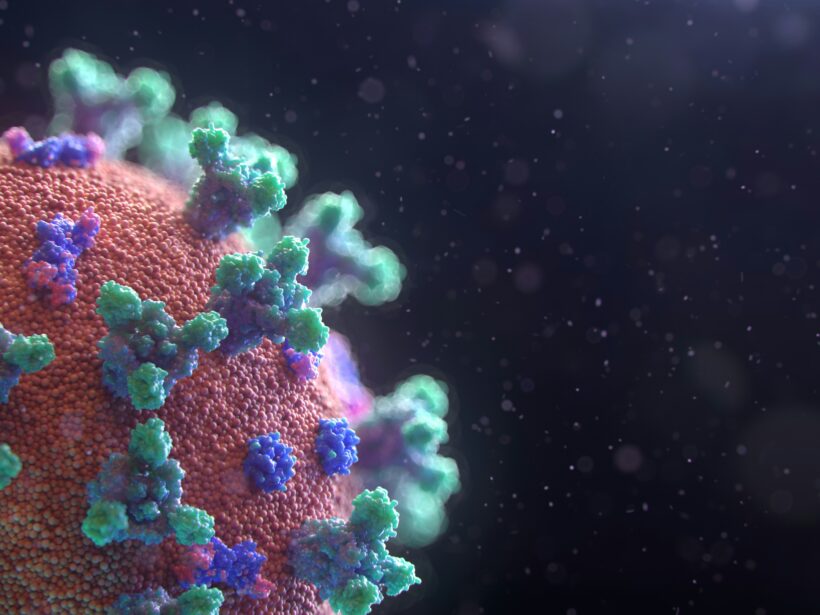Am Universitätsklinikum Jena organisierte Martin Walter, Leiter der dortigen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, am 18./19. November den ersten Long-Covid-Kongress – die große Resonanz überraschte ihn. Im MedWatch-Interview kritisiert Walter fehlende Gelder für die Forschung, eine Stigmatisierung Betroffener und „Radikalisierungstendenzen“ in der Wissenschaft.
MedWatch: Am Long-Covid-Kongress nahmen vor Ort in Jena und online mehr als 2.500 Ärzt:innen und Betroffene teil. Was sagt dieses große Interesse aus?
Martin Walter: Einerseits betrifft Long Covid sehr viele Menschen, andererseits können wir bisher sehr wenig für sie tun. Betroffene, Angehörige, Arbeitgeber und natürlich auch die Ärzteschaft sehen sich auf einen Schlag mit großen Ungewissheiten konfrontiert. Zahlreiche Patienten erleben ihre Ärzte als schlecht informiert und überfordert. Es braucht dringend Abhilfe.
MedWatch: Die Ursachen für Long-Covid-Symptome sind nicht geklärt. Das gilt auch für das schwerwiegende Chronische Fatigue Syndrom (ME/CFS). Es wird bei einem Teil der Long-Covid-Betroffenen diagnostiziert und hat zudem bereits vor CoronaCorona Mit Corona bezeichnet die Allgemeinbevölkerung zumeist SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2). Es ist ein neues Beta-Coronavirus, welches zu Beginn des Jahres 2020 als Auslöser der Krankheit COVID-19 identifiziert wurde. Coronaviren waren schon vor 2020 altbekannt. In Menschen verursachen sie vorwiegend milde Erkältungskrankheiten (teils auch schwere Lungenentzündungen) und auch andere Wirte werden von ihnen befallen. SARS-CoV-2 hingegen verursacht wesentlich schwerere Krankheitsverläufe, mit Aufenthalten auf der Intensivstation bis hin zum Tod. Der Virusstamm entwickelte und entwickelt seit seiner Entdeckung verschiedene Virusvarianten, die in ihren Aminosäuren Austausche aufweisen, was zu unterschiedlichen Eigenschaften bezüglich ihrer Infektiosität und der Schwere eines Krankheitsverlaufes führt. Seit Dezember 2020 steht in Deutschland ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zur Verfügung. mindestens zehntausende Menschen in Deutschland ereilt, oft nach Virusinfektionen. Manche Vertreter der Psychosomatik und der Neurologie stufen ME/CFS als vor allem psychosomatisch ein – wesentliche Protagonisten dieser Sichtweise waren beim Kongress jedoch nicht vertreten. Durften sie nicht oder wollten sie nicht?
Walter: Sie hätten gedurft und waren als Vortragende oder Teilnehmende auch eingeladen. Am Ende gab es eine adäquate Vertretung der wesentlichen Fachrichtungen, und der Kongress hat gezeigt, wie differenziert die Betrachtung von Long Covid ist. In der Abgrenzung zwischen körperlichen und psychischen Ursachen gibt es noch viele Unklarheiten. Da wird schnell emotional statt sachlich diskutiert. Wir sehen hier auch eine Radikalisierung in der wissenschaftlichen Debatte. Es ist eine Extremposition zu sagen: Wenn mit herkömmlichen Methoden keine neurologischen Befunde zu ermitteln sind, muss eine Krankheit psychologisch oder psychisch bedingt sein und die Behandlung ausschließlich hier ansetzen. Eine solche Aussage ist problematisch, weil sie zur Stigmatisierung von Betroffenen genutzt werden kann.

MedWatch: Kämpfen hier verschiedene Fachrichtungen um die Patient:innen?
Walter: Das sehe ich nicht. Es ist leider eher so, dass niemand diese Patienten haben will. Keine Fachrichtung kann ein belastbares Therapieangebot vorweisen, alle sind überfordert und besonders lukrativ ist die Behandlung der Long-Covid-Patienten auch nicht. Ich denke, hier übertragen sich Radikalisierungstendenzen aus der Gesellschaft auch auf die Wissenschaft.
MedWatch: Als Ausrichter mussten Sie sich in Jena mit zwei kleineren Demonstrationen gegen den Kongress auseinandersetzen – ist das die Radikalisierung, die Sie meinen?
Walter: Bei diesen Kundgebungen wurde Ärzten, die Covid-Erkrankungen als Problem beschreiben, pauschal die wissenschaftliche Existenzberechtigung abgesprochen. Diskussionen verkürzen sich auf Extrempositionen, gerade auch in den sozialen Medien. Das macht die Spaltung der Gesellschaft gut erkennbar. Aber auch klassische Medien stellen polarisierende Extrempositionen oft zu stark heraus. Dasselbe erlebe ich auch beim Thema Long Covid. Solche Meinungen sind besonders laut, aber nicht repräsentativ für den wissenschaftlichen Diskurs, der nur in seiner Differenziertheit sinnvoll ist. Für diesen und für unsere Patienten schadet es eher, sich durch unangemessen radikale Behauptungen mit kalkulierter Wirkung in der Öffentlichkeit hohe Aufmerksamkeit für die eigene Position zu verschaffen.
MedWatch: Welchen Blick haben Sie als Professor für Psychiatrie auf die Ursachen von Long Covid und ME/CFS?
Walter: Vor 15 Jahren hätte ich die Fatigue wahrscheinlich auch noch als psychosomatisch eingestuft. Mit dem heutigen Wissen können wir hingegen sehen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit organische Ursachen gibt. Eine Mehrzahl der Studien berichtet von entzündlichen Prozessen, von Veränderungen im Blutkreislauf und im Nervensystem. Allerdings sind die körperliche und die psychische Dimension enger miteinander verbunden, als das oft gesehen wird. Wir müssen aber auch unterscheiden zwischen der ursächlichen Betrachtung und der therapeutischen Konsequenz.
MedWatch: Was bedeutet das?
Walter: Organische Erkrankungen können psychische Probleme auslösen. Umgekehrt treten zum Beispiel bei manchen Depressionen Entzündungsprozesse auf, und außerdem wissen wir, dass psychotherapeutisches Handeln einige Entzündungswerte im Blut beeinflussen kann. Es gibt Krankheitsbilder mit einer klaren organischen Ursache, die wir aber nicht behandeln können – während sich den daraus resultierenden psychischen Problemen mit psychotherapeutischen Verfahren begegnen lässt. Bei Long-Covid- und Fatigue-Patienten halte ich die psychotherapeutische Dimension für besonders wichtig. Jemand, der monatelang aus dem Berufsleben herausgerissen wurde, der vielleicht eine aktive Stigmatisierung erlebt, hat oft auch einen Bedarf zu verarbeiten, was diese Erfahrung mit ihm macht. Es ist daher kein Widerspruch, eine somatische Erkrankung auch mit Mitteln der Psychotherapie zu behandeln. Derzeit können wir hier aber weniger leisten, als wir könnten.
Körperliche Erkrankungen sind in unserer Gesellschaft akzeptiert, psychische nicht.
MedWatch: Aus welchem Grund?
Walter: Ich habe erlebt, dass manche Patienten auch als Folge dieser Debatten dafür nicht offen genug sind. Körperliche Erkrankungen sind in unserer Gesellschaft akzeptiert, psychische nicht. Sie sind mit einer Entwertung belegt. Unsere Aufgabe als Ärzte ist es deshalb, dieser Stigmatisierung entschieden entgegenzutreten. Bei ME/CFS ist die Situation sehr komplex. Jahrelang haben Ärzte ihre eigene Unsicherheit auf Patienten übertragen. Die wurden pauschal an die Psychiatrie überwiesen, ihre körperlichen Symptome nicht anerkannt. Dagegen haben sich die Betroffenen gewehrt – und den Fokus auf das rein Organische gelegt. Das ist nachvollziehbar, war für die therapeutische Konsequenz aber nicht nur gut: Wir dürfen Entstigmatisierung nicht mit Entpsychiatrisierung verwechseln. Bei Long Covid hat immerhin etwa ein Fünftel der Patienten psychische Beeinträchtigungen. Die können wir lindern.
MedWatch: Welche Rolle spielen psychische Vorerkrankungen für das Long-Covid-Risiko?
Walter: Die Datenlage dazu ist bisher nicht eindeutig. Am ehesten lässt sich sagen, dass Menschen, die zum Zeitpunkt der Covid-Infektion oder vorher an einer leichten psychischen Erkrankung litten, ein höheres Risiko für Long Covid haben. Das ist aber gerade kein Beweis dafür, dass Long Covid eine psychische Erkrankung ist. Wir kennen auch nach Grippe-Erkrankungen das Sickness Behaviour, das sich ein bisschen wie eine DepressionDepression Die Depression ist eine schwere psychische Erkrankung, die sich durch zahlreiche Beschwerden äußert und in jedem Alter auftreten kann. Niedergeschlagenheit, Erschöpfung, ein Leben ohne Antrieb und Interesse gehören ebenso zur breiten Palette der Symptome als auch körperliche Beschwerden wie Schlaflosigkeit, Appetitstörungen und Schmerzen. Auch die Entwicklung von Suizidgedanken gehört zum Symptomspektrum. Nur wenige können sich selbst helfen, zudem sind Frauen doppelt so häufig von dieser Störung betroffen als Männer. Durch ihr vielfältiges Erscheinungsbild wird die Depression vom Hausarzt oft nicht erkannt. Dabei lässt sie sich mit psychotherapeutischen Behandlungen, wenn nötig auch mit Medikamenten, sehr gut behandeln. anfühlt. Wer depressiv vorbelastet ist, den befällt dieses Symptom häufiger. Vergessen wir bei alledem aber nicht, wie viele Menschen das betrifft: Jeder fünfte entwickelt irgendwann in seinem Leben eine psychische Erkrankung. Wenn ein Mensch mit psychischen Symptomen auf körperliche Erkrankungen reagiert, ist das keineswegs ein Anzeichen für eine grundsätzliche Veranlagung des Einzelnen.
MedWatch: In seinem Vorbericht über das Chronische Fatigue Syndrom empfiehlt das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) die Graded Exercise-TherapieTherapie Therapie bezeichnet eine Heil- oder Krankenbehandlung im weitesten Sinn. Es kann hierbei die Beseitigung einer Krankheitsursache oder die Beseitigung von Symptomen im Mittelpunkt stehen. Ziel einer jeden Therapie ist die Widerherstellung der physischen und psychischen Funktionen eines Patienten durch einen Therapeuten. Soweit dies unter den jeweiligen Bedingungen möglich ist. (GET), die in der Psychosomatik und der Psychiatrie genutzt wird. Betroffenenverbände sprechen hingegen von einer massenhaften Fehlbehandlung, weil GET auf Bewegung setzt und die Belastungsintoleranz als Leitsymptom der Fatigue ignoriere. Beim Kongress kam auch aus der Forschung der Hinweis, dass die Therapie Schaden anrichten könne. Wie sehen Sie das?
Walter: Als Ärzte müssen wir verlangen, dass Empfehlungen evidenzbasiert sind. Wo das nicht der Fall ist, müssen wir Korrekturen einfordern. Die Betroffenen haben hier einen wichtigen Punkt, wenn sie sagen: Die schädigenden Nebenwirkungen dieser Therapie wurden unterbewertet, die Berichte über einen möglichen Nutzen überbewertet und die Studienlage nicht kritisch genug analysiert. Der IQWiGIQWIG Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat als Hauptaufgabe die Evaluierung einer Nutzen-Schaden-Abwägung medizinischer Maßnahmen für Patient*innen. Es wurde im Zuge der Gesundheitsreform 2004 gegründet. Das IQWIG ist eine fachlich unabhängige wissenschaftliche Einrichtung, die das Ziel verfolgt, evidenzbasierte Entscheidungen in Gesundheitsfragen zu unterstützen. Auch möchte sie einer breiten Öffentlichkeit Gesundheitsinformationen zugänglich zu machen. Dafür informiert es in verständlicher Form u.a. mit Hilfe von Informationsberichten, Kurzantworten und Merkblättern auf seiner Internetseite unabhängig und evidenzbasiert, sowohl für Fachkreise als auch für eine breite interessierte Öffentlichkeit.-Bericht ist deshalb nicht so zurückhaltend, wie es die unsichere Datenlage und die Hinweise auf eine schädigende Wirkung erfordern würden. Bei einer aktivierenden Therapie müssen wir uns ganz stark an den individuellen Belastungsgrenzen orientieren. Es gibt hier nicht die eine Behandlung für die eine Diagnose.
MedWatch: Geht es nach den Empfehlungen mancher Kassenärztlichen Vereinigung, müssten die Hausärzte Long-Covid-Patienten zu fünf verschiedenen Fachärzten überweisen – für Betroffene ist das kaum zu schaffen. Wir gut ist die Ärzteschaft darauf vorbereitet, dass plötzlich hunderttausende Erkrankte mit einer großen Vielfalt unterschiedlichster Symptome in die Praxen kommen?
Walter: Wir sind garantiert nicht gut vorbereitet. Es ist unklar, welcher Facharzt welche Symptome behandeln soll, die Schnittstellen sind nicht definiert, es fehlen Kriterien für Diagnostik und Therapie und eine Struktur für die Zusammenarbeit. In der Krebsmedizin sind interdisziplinäre Boards, in denen sich die beteiligten Ärzte austauschen, ein fester Bestandteil. Das könnte ein Vorbild sein. In Jena versuchen wir, das im Kleinen zu lösen. In unserem Long-Covid-Zentrum haben Internisten die Federführung, aber sie arbeiten eng mit vielen Spezialambulanzen der unterschiedlichsten Fachrichtungen zusammen und legen gemeinsam die Behandlungsschwerpunkte für jeden Patienten fest. Long-Covid ist kein Thema für nur eine Fachrichtung.

MedWatch: Wie entscheidend ist es für die Therapieentwicklung, zunächst mehr über die Ursachen zu wissen?
Walter: Wir behandeln in der Medizin viele Krankheiten symptomatisch, und ehrlicherweise wissen wir bei vielen Medikamenten noch nicht genau, warum sie wirken. Natürlich ist es wichtig, an den Ursachen zu forschen – wir können jedoch nicht darauf warten, bis wir die Mechanismen von Long Covid mit letzter Sicherheit kennen um dann erst mit der Entwicklung neuer gezielter Therapien zu beginnen. Dann würde es noch Jahre dauern, bis diese beim Patienten ankommen. Deshalb dürfen wir die Therapie- und Versorgungsforschung nicht vernachlässigen. Bisher passiert da viel zu wenig. In den USA sind eine Milliarde Dollar öffentliche Gelder in die Long-Covid-Forschung geflossen – in Deutschland hat der Bund gerade zehn Millionen Euro in Aussicht gestellt. Diese Unterfinanzierung steht in keinem Verhältnis zum Leiden der Patienten und zum ökonomischen Schaden von Long Covid. Das Forschungspotenzial in Deutschland ist da, es fehlt am Geld.
Redaktion: Nicola Kuhrt