Wie nehmen Menschen in Deutschland die Entwicklungen rund um das neuartige Coronavirus wahr? Fühlen sie sich bedroht, haben sie Angst? Seit drei Wochen führt das Forschungsprojekt Cosmo eine Online-Umfrage zu diesen Fragen durch und veröffentlicht den Bericht zur „psychologischen Lage“ im Land. Finanziert wird das Projekt von der Universität Erfurt, dem Robert Koch-InstitutRobert Koch-Institut Das Robert-Koch-Institut (RKI) ist ein Bundesinstitut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Seine Kernaufgaben sind die Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, insbesondere von Infektionskrankheiten. Das Robert-Koch-Institut wirkt bei der Entwicklung von Normen und Standards mit. Es informiert und berät die Fachöffentlichkeit, sowie die breite Öffentlichkeit. und dem Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation. Weitere Projektpartner sind das Bernhard Nocht Institut für Tropenmedizin, das Science Media Center und das Yale Institute for Global Health.
MedWatch hat mit einer der Initiatoren gesprochen: Cornelia Betsch ist Psychologin und Professorin für Gesundheitskommunikation an der Universität Erfurt. Sie war auch Mitglied des Experten-Beirats des Projekts zum Umgang mit Falschinformationen im Internet, das MedWatch im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung organisiert hat.
MedWatch: Wie gut ist die Bevölkerung über die PandemiePandemie Pandemie bezeichnet eine globale Epidemie, eine zeitlich begrenzte und zugleich weltweit stattfindende Infektionskrankheit. Fehlende Grundimmunitäten gegen, z.B. neu mutierte, Bakterien- oder Virenstämme erhöhen Infektions- und Todesraten. Während einer Pandemie mit schweren Krankheitsverläufen sind Überlastungen von Gesundheitsversorgungsstrukturen und des öffentlichen Lebens schnell erreicht. Bekannte Beispiele für durch Viren hervorgerufene Pandemien sind HIV (seit den 80er Jahren), das Influenza-A-Virus (H1N1) von 2009 sowie Corona (seit 2019). Der weltweite Handel, eine globale Mobilität sowie immer weniger Rückzugsorte für andere Lebewesen begünstigen nicht nur die Entstehung von Infektionskrankheiten, sondern auch deren Ausbreitung. Die WHO kontrolliert in einem ständigen Prozess das Auftreten und die Verbreitung von Infektionskrankheiten, die potentiell epidemisch oder pandemisch werden könnten. und ihre Folgen informiert, Frau Betsch?
Cornelia Betsch: In unserer Umfrage zeigte sich, dass das Wissen über Covid-19Covid-19 COVID-19 ist ein Akronym für die englische Bezeichnung Coronavirus Disease 2019, was so viel wie Corona-Virus-Krankheit 2019 heißt. Sie wird von dem neuen Beta-Coronavirus SARS-CoV-2 und seinen Varianten ausgelöst. Eine Erkrankung mit COVID-19 äußert sich zumeist – ca. vier bis sechs Tage nach Infektion – relativ unspezifisch durch Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber sowie Störungen des Geruchs- und/oder Geschmackssinns. Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Schwäche oder auch Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall können hinzukommen. Die Symptome können je nach Virusvariante variieren. Auch schwere Verläufe mit Aufenthalten auf der Intensivstation bis hin zum Tod sind möglich. relativ hoch ist, wie auch das Wissen über Schutzverhalten relativ hoch ist. Aber es bestehen durchaus noch Unsicherheiten. Wir sehen auch, dass hohes Wissen mit mehr Schutzverhalten einhergeht. Aber wie im echten Leben führt das Wissen, dass Sport gut ist, nicht zwingend dazu, dass wir auch mehr Sport machen. Und genauso ist es jetzt auch. Nur ist es noch relevanter, dass wir uns jetzt an die Regeln halten. Wissensvermittlung ist weiter wichtig und es ist auch wichtig, den Leuten irgendwas an die Hand zu geben, wie sie diese wichtigen Hinweise umsetzen können.
MedWatch: Was meinen Sie konkret?
Betsch: Auch bei so einfachen Sachen wie der Bitte, zu Hause zu bleiben, wenn man krank wird, führt Wissen nicht unbedingt zu Verhalten. Die Leute wissen das, tun es aber nicht. Oder auch beim Händewaschen oder dem Meiden von Orten, an denen sich viele Leute aufhalten. Eigentlich wissen es alle, tun es aber nicht ausreichend.
MedWatch: Womit erklären Sie sich das?
Betsch: Wir sehen interessanterweise, dass besser gebildete Leute weniger Schutzverhalten an den Tag legen. Was genau da der Hemmschuh ist, kann ich nicht so richtig sagen. Ich weiß nicht, ob das eine Sorglosigkeit ist. Die Regeln kennt man ja schon lange – Händewaschen war auch vorher schon sinnvoll, aber jetzt kann es wirklich Leben retten. Die Compliance bei diesen Regeln ist bei Menschen mit höherer Bildung schlechter.
MedWatch: Wie bewerten Sie die Krisenkommunikation der Bundesregierung und der Behörden – erreichen sie die Menschen nicht?
Betsch: Doch, die Daten zeigen: Das Wissen kommt an. Auch das Vertrauen in die Behörden ist hervorragend – es ist noch gestiegen seit letzter Woche. Das Robert-Koch-Institut hat Top-Werte. Die Verantwortlichen kommunizieren auch Unsicherheiten und revidieren, wenn nötig, Dinge, die heute anders sind als gestern. Das ist in der Krise nun mal so. Ich glaube, dass das Einmaleins der Krisenkommunikation sitzt. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass auch die Politiker nur Menschen sind und unter diesem Druck auch mal etwas in die Hose gehen kann, das ist der Situation geschuldet, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es gut.
MedWatch: Gibt es noch was zu verbessern?
Betsch: Ein Problem ist es, wenn gesagt wird: Vermeide physischen Kontakt. Wer bricht das für den Menschen runter? Was heißt das für mich und meine Kinder – dürfen die noch Freunde sehen und wenn ja, einen, zwei oder doch mehr? Ist es heute so – und morgen auch noch? Was ist mit Kindern von Scheidungseltern, dürfen die dann zum anderen Elternteil? Das wird alles sehr wenig persönlich heruntergebrochen. Da braucht es wahrscheinlich die Journalisten – aber ich würde mir eigentlich wünschen, dass irgendjemand die Kommunikation auch aufseiten der Regierung in die Hand nimmt. Das ist ja teils in der Ansprache der Bundeskanzlerin passiert. Das ist das, was die Leute sich wünschen und was Unsicherheit reduziert.
MedWatch: Das BundesgesundheitsministeriumBundesgesundheitsministerium Das Bundesgesundheitsministerium, oder auch Bundesministerium für Gesundheit, erarbeitet Gesetzesentwürfe, Rechtsverordnungen sowie Verwaltungsvorschriften. Zu seinen Aufgaben gehört es die Leistungsfähigkeit der Gesetzlichen Krankenversicherung sowie der Pflegeversicherung zu erhalten, zu sichern und weiterzuentwickeln. Es ist zuständig für die Reform des Gesundheitssystems. Wichtige Punkte sind zudem die Bereiche Gesundheitsschutz, Krankheitsbekämpfung und Biomedizin. Auch kümmert es sich und die Rahmenvorschriften für Herstellung, klinische Prüfung, Zulassung, Vertriebswege und Überwachung von Arzneimitteln und Medizinprodukten, sowie um die Sicherheit biologischer Arzneimittel wie Blutprodukte. Berufsgesetze für die Zulassung zu den bundesrechtlich geregelten Heil- und Gesundheitsberufen gehören ebenso zu seinem Aufgabenspektrum. hat am Wochenende vor Falschnachrichten gewarnt, nach denen die Bundesregierung härtere Maßnahmen ergreifen würde – doch genau diese kamen dann kurz nach dem Tweet. Zerstört sowas nicht sehr viel Vertrauen?
Betsch: Ich fand es auch unklug, aber wir sollten das nicht breittreten. Wie schon gesagt: das sind auch nur Menschen. In einer Krise ist es wichtig, dass man nicht etwas sehr stark dementiert oder behauptet, das morgen vielleicht anders ist. Wichtig ist immer zu sagen, dass alles vorläufig ist und jeden Tag klug entschieden wird, was richtig und der Lage angemessen ist. Das hat die Kanzlerin sehr klar gemacht. Wir sollten uns, statt kleine Fehlerchen in der Kommunikation zu suchen, lieber um andere wichtige Themen kümmern: Wie sorgen wir für den sozialen Frieden? Wir müssen Geschichten erzählen über Solidarität – darüber, wie viele Menschen sich an die Regeln halten. Für mich allein fühlt es sich bescheuert an, meinem Freund zu sagen: Ich lade dich heute Abend nicht zum Essen ein, obwohl wir uns seit drei Wochen verabredet haben. Ich muss wissen, dass andere das auch tun. Ich muss die Geschichten der Solidarität hören. Natürlich ist der Grat ein schmaler: wir wollen nicht in Panik geraten, wir müssen trotzdem alle handeln. Es ist ernst und der Ausgang ist offen, hat Frau Merkel gesagt. Jeder muss mitmachen. Da finde ich es wichtig, dass wir uns dabei nicht verlieren.
MedWatch: Wie meinen Sie das?
Betsch: Es gibt viele Selbstständige, die mit dem Rücken an der Wand stehen und jeden Tag ums Überleben kämpfen. Dann gucken sie aus dem Fenster und sehen die alten Leute im Café sitzen. Das schafft Unfrieden – da muss es mehr Bewusstsein geben und die Generationen sich irgendwie miteinander verständigen. Bei Fridays for Future sagen die Jugendlichen den Alten, Ihr habt unsere Zukunft geklaut – jetzt sind die Alten auf die Jungen angewiesen und sagen: Bitte bleibt ihr jetzt auch für uns zu Hause. Da müssen die Älteren aber auch mitmachen. Es gibt so viele 60- und 70-Jährige, die sagen, dass sie ja noch nicht 80 sind und sich risikoreich verhalten. Irgendwann landen viele von ihnen dann vielleicht im Krankenhaus und es kommt zur befürchteten Überlastung.
MedWatch: Ist den Menschen in Deutschland allgemein nicht ausreichend bewusst, wie groß das Risiko für sie selbst und ihre Angehörigen ist?
Betsch: Wir machen die Umfragen jetzt schon die dritte Woche: Am Anfang haben nur 17 Prozent gesagt, dass sie sich wahrscheinlich infizieren – nach drei Wochen sind es schon 33 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit steigt, aber wenn man das jetzt mit den Werten vergleicht, dass 60 oder 70 Prozent in der Bevölkerung infiziert werden könnten, dann hinkt das hier immer noch hinterher. Generell kann man sagen, dass es diese Woche einen ordentlichen Sprung gegeben hat in der Risikowahrnehmung: In den Sorgen und in der Angst, auch wie dominant dieses Thema ist. Das hat diese Woche doch spürbar zugenommen.
MedWatch: Welches war für Sie das überraschendste Ergebnis der Umfrage?
Betsch: Sehr wichtig ist, dass die Risikowahrnehmung besonders älterer Menschen niedriger ist als die von Jüngeren. Sie denken, sie kriegen es wahrscheinlich nicht. Sie wissen und denken, dass es schwerwiegender für sie ist als für junge Menschen. Ältere Menschen scheinen zu denken, sie werden es schon nicht kriegen. Überrascht hat mich, dass die Maßnahmen sehr gut akzeptiert werden – auch sehr restriktive Maßnahmen sind hoch akzeptiert. Sogar die Ausrufung des Katastrophenfalls, da gibt es mehr Zustimmung als Ablehnung. Es ist eine Situation großer Unsicherheit – dass das Vertrauen so steigt und die Maßnahmen wie Schulschließungen so gut akzeptiert werden zeigt auch, dass die Menschen klare Regeln wollen. Vielleicht auch, um eine Gleichheit herzustellen: wenn alle nicht rausdürfen, dann muss ich meinen Kindern auch nicht erklären, warum sie nicht auf den Spielplatz dürfen, ihre Freunde aber schon. Oder wenn ein Restaurant sein Personal in Kurzarbeit schickt und ums Überleben kämpft und draußen die Risikogruppe gemeinsam Kaffee trinkt.
MedWatch: Was müsste getan werden, damit das Wissen der Menschen sie auch dazu bringt, es umzusetzen und zuhause zu bleiben?
Betsch: Solange wir keine strikteren Maßnahmen haben: Auch innerhalb der Familie die sozialen Normen kommunizieren. Zu sagen: Ich bleibe zuhause, Du bleibst auch zu Hause – dass man in den Familien zur Not auch den Konflikt sucht, dass man die Kinder nicht zu den Großeltern gibt und dass man sagt: Mein Zeichen von Liebe für dich ist gerade, dass wir dich nicht besuchen. Dafür rufe ich Dich an. Diese Sachen, die so gebetsmühlenartig wiederholt werden, sind das Einzige, was wir im Moment tun können. Einen in der Familie zum Einkaufen zu schicken und nicht zu zweit in den Supermarkt zu gehen, solche Sachen. Denn die Fallzahlen, die wir heute sehen, sind die Infizierten von vor bis zu zwei Wochen. Und die haben in der Zwischenzeit ja auch schon viele andere infiziert, die das jetzt noch nicht wissen, aber andere infizieren. Deswegen werden wir es auch aushalten müssen, dass die Fallzahlen weiter steigen – egal wie sehr uns jetzt einschränken. Das ist natürlich psychologisch bescheuert: Ich tue etwas und werde dafür nicht belohnt. Darauf sollten wir als Gesellschaft vorbereitet werden: Dass die Welle weiter rollt und wir erst in Tagen oder vielleicht Wochen sehen, dass es gut war, was wir tun.
MedWatch: Werden denn alle Teile der Bevölkerung ausreichend gut erreicht – kommen die Informationen in den Communities an? Nicht jeder hört ja den Podcast mit dem Virologen Christian Drosten.
Betsch: Das kann ich nicht richtig einschätzen – ich weiß nur, dass es viele offizielle Informationen auch in anderen Sprachen gibt. In meiner Fantasie wäre es eigentlich ideal, wenn man die Informationen in die Supermärkte hängt – dort müssen die Leute hin und das ist auch bald der einzige Ort, wo sie noch hindürfen.
MedWatch: Welche Menschen erreichen Sie mit der Umfrage?
Betsch: Das sind tausend Leute, repräsentativ für Alter und Geschlecht und Bundesland – aber nur bis zum Alter von 75. Die älteren Onliner sind eine andere Stichprobe, deswegen haben wir da Schluss gemacht. Aber das ist eigentlich eine wichtige Gruppe und eine Einschränkung unserer Studie.
MedWatch: Schon angesichts der aktuellen Einschränkungen werden die Leute zunehmend angespannter, teils traurig bis depressiv und auch ein bisschen panisch. Wie lange kann es so weitergehen, ohne dass es eskaliert? In Wuhan dürfen die Menschen ja seit rund zwei Monaten nicht auf die Straße.
Betsch: Dazu wird gerade geforscht – wir haben mit dem Leibniz-Institut für Resilienzforschung Kontakt, die haben sich an uns gewandt, auch mit dem Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche werden wir dazu kooperieren. Wir wollen in den nächsten Wochen auch immer wieder genauer hinschauen, wie es den Leuten geht, wie können sie damit umgehen, was hilft ihnen durch diese Zeit durch.
MedWatch: Haben Sie Tipps für Menschen – auch jene, die psychische Erkrankungen haben? Eine Frage ist ja auch, wie die psychische Versorgung weitergehen kann.
Betsch: Vereinzelt ist so viel ich weiß schon eine Therapiesitzung über Video oder Telefon möglich – man muss dringend umdenken. Denn gerade für Leute, die sowieso schon psychisch in einer schwierigen Situation sind, ist es ganz furchtbar, wenn sie plötzlich den ganzen Tag alleine sind müssen – oder wenn sie den Stress nicht verarbeiten können. Es ist hoch relevant.
MedWatch: Warum haben Sie die Umfragen gestartet?
Das war eine von heute-auf-morgen-Entscheidung: Ich habe meiner Gruppe gesagt wir sollten das tun, dann ist das sehr schnell sehr gewachsen. Sehr viele gute Leute arbeiten da mit viel Herzblut rund um die Uhr, jeder in seinem Wohnzimmer oder in seiner Küche. Ich fand es einfach wichtig, dass wir das untersuchen: In der Krise ist Vertrauen in die Regierung, die Behörden und das GesundheitssystemGesundheitssystem Das deutsche Gesundheitssystem ist ein duales Krankenversicherungssystem bestehend aus der GKV (Gesetzlichen Krankenversicherung) und der PKV (private Krankenversicherungen). Seit der Gesundheitsreform 2007 muss jeder, der in Deutschland seinen Wohnsitz hat, eine Krankenversicherung haben. Wichtig ist zudem das Prinzip der Selbstverwaltung und der Sachleistung. D.h. Krankenkassen erfüllen die ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben in eigener Verantwortung. Es existiert eine gemeinsame Selbstverwaltung der Leistungserbringer und Kostenträger. Wichtigstes Organ hierbei auf Bundesebene ist der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA). wahnsinnig wichtig. Und wir müssen darüber Bescheid wissen und die Faktoren kennen, die die Risikowahrnehmung und das Verhalten beeinflussen. Wir wissen jetzt, dass die älteren Leute ihr Risiko unterschätzen. Jetzt kann man darauf reagieren. Wir wissen, dass Menschen mit höherer Bildung weniger Schutzverhalten zeigen – jetzt kann man darauf reagieren.
MedWatch: Und wie werden die Ergebnisse genutzt?
Betsch: Wir schicken das Ganze an alle Partner und an die Ministerien. Über das Bundesgesundheitsministerium wird es dann auch dem Krisenstab zur Verfügung gestellt. Es geht auch an die Journalisten, weil wir es wichtig finden, dass Sachen auch richtiggestellt werden können. Ansteckungspartys – also absichtliches Anstecken – finden wir zum Beispiel nur bei drei Prozent. Und wir wollen jenen, die in der Verantwortung stehen, Feedback und Sicherheit geben: Wenn sie wissen, dass die Maßnahmen gut akzeptiert sind, dann können sie mit einer anderen Sicherheit regieren. Wir erwarten von unseren Politikern, dass sie uns Sicherheit vermitteln – aber die muss irgendwo herkommen. Und das versuchen wir mit dieser Studie, sowie auch zu melden, wenn irgendwas schräg läuft. Dadurch versuchen wir, dazu beizutragen, dass wir alle gut durch diese Krise kommen und möglichst effektiv unser Verhalten ändern können.
MedWatch: Die Situation ist komplex.
Betsch: Es fühlt sich so unglaublich bescheuert an, was wir da gerade tun. Wir gucken nach draußen und es sieht alles aus wie immer: Nichts draußen zeigt uns, dass da irgendwie eine Gefahr lauert – und wir müssen trotzdem das Richtige tun. Da hilft es zu wissen, dass andere Leute dasselbe tun. Wir sehen in der Umfrage, dass die Bereitschaft riesig ist, sich einzuschränken – was auch viele Leute tatsächlich tun. Das hilft, sich zu solidarisieren und nicht zu denken: Ich bin hier der einzige Idiot, der sich einschränkt. Dafür sind diese Daten wichtig und ich würde mich auch freuen, wenn das breit kommuniziert wird.
MedWatch: Besteht die Gefahr, dass die Krise die Gesellschaft weiter spaltet?
Betsch: Laut der Umfrage ist es eine der wichtigsten Sorge, dass die Menschen egoistischer werden, das treibt viele schon um. Wir haben schon einen ungelösten Generationenkonflikt mit Fridays-for-Future und dem Klimawandel. Vielleicht kann man jetzt irgendwie diese Situation nutzen: Wo nicht gereist und geflogen wird und das Leben irgendwie zum Stillstand kommt und jetzt die Jungen sich einschränken für die Alten. Vielleicht kann das irgendwie auch eine Chance sein, dass man sich da verständigt und neue Generationenverträge macht.



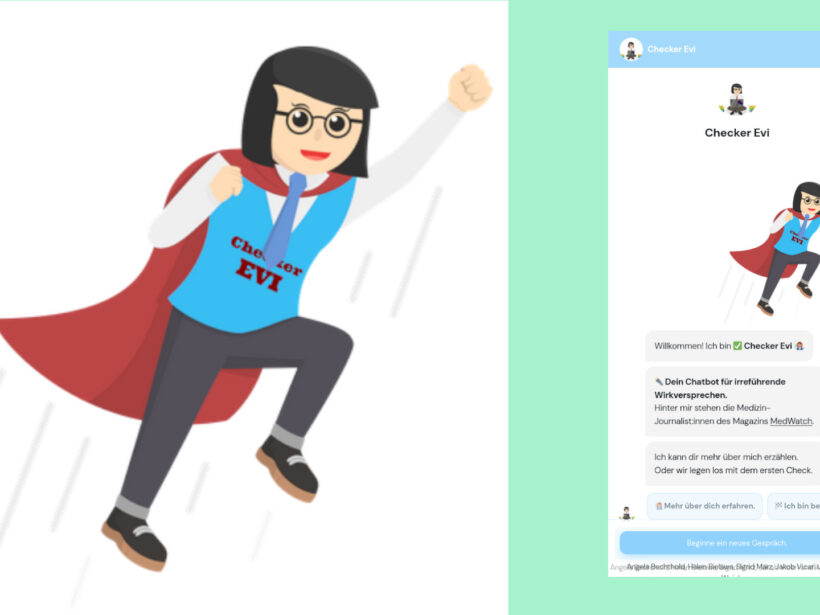





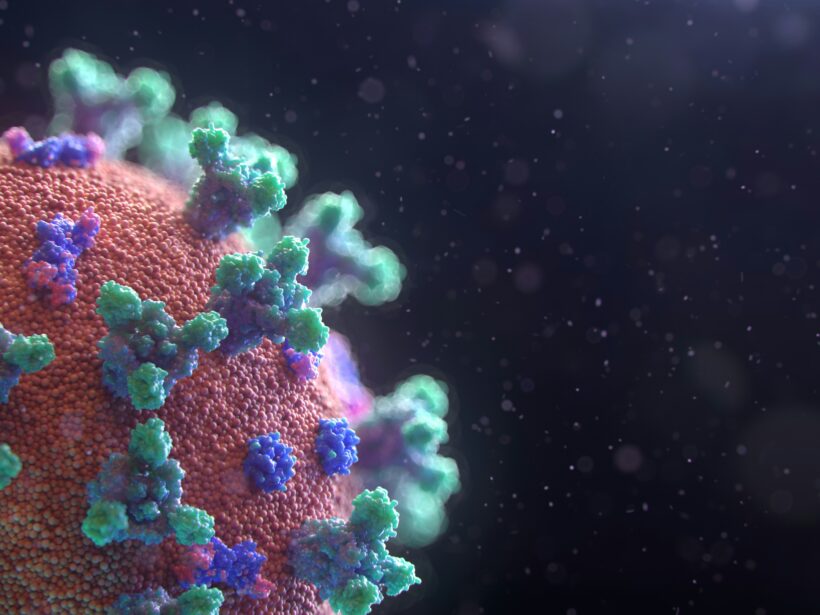



Danke für diesen Artikel.
Gerade der letzte Punkt mit dem Generationskonflikt und Fridays-for-Future ist meiner Meinung nach keine Chance, sondern ein Risiko. Wir leben seit Jahren (Jahrzehnten) in einer Situation in der die ältere Generation auf Kosten der jüngeren lebt. In mehreren Dimensionen: Naturschutz und Finanzieller Erfolg.
Jetzt kommt der Risikofaktor CoronaCorona Mit Corona bezeichnet die Allgemeinbevölkerung zumeist SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2). Es ist ein neues Beta-Coronavirus, welches zu Beginn des Jahres 2020 als Auslöser der Krankheit COVID-19 identifiziert wurde. Coronaviren waren schon vor 2020 altbekannt. In Menschen verursachen sie vorwiegend milde Erkältungskrankheiten (teils auch schwere Lungenentzündungen) und auch andere Wirte werden von ihnen befallen. SARS-CoV-2 hingegen verursacht wesentlich schwerere Krankheitsverläufe, mit Aufenthalten auf der Intensivstation bis hin zum Tod. Der Virusstamm entwickelte und entwickelt seit seiner Entdeckung verschiedene Virusvarianten, die in ihren Aminosäuren Austausche aufweisen, was zu unterschiedlichen Eigenschaften bezüglich ihrer Infektiosität und der Schwere eines Krankheitsverlaufes führt. Seit Dezember 2020 steht in Deutschland ein Impfstoff gegen SARS-CoV-2 zur Verfügung.. Und hier fordert die ältere Generation wieder, dass die jüngere Generation sich für sie einschränkt.
Ich glaube wir stehen vor einen großen Generationenkonflikt. Dieser ist aber nicht jetzt erst entstanden, sondern ruht aus einer Mentalität des “Nehmens” der älteren Generation und zeichnet sich seit Jahren ab.